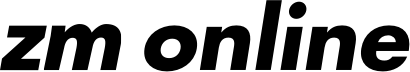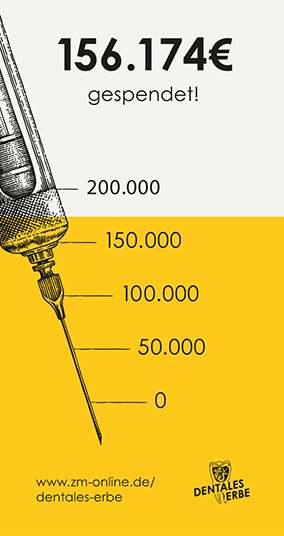Hyperkinetische Störungen bei Kindern und Jugendlichen
Erscheinungsbild und Klassifikation: Hyperkinetische Störungen (HKS) sind eine der häufigsten Verhaltensstörungen im Kindesalter. Gemäß der American Psychiatry Association (1994) tritt die Störung bei drei bis sechs Prozent der Schulkinder auf, wobei Jungen sechs bis neun Mal häufiger betroffen sind als Mädchen. Das Symptomspektrum bei HKS lässt sich in die Bereiche der primären und der sekundären Symptomatik unterteilen. Die primäre Symptomatik ist gekennzeichnet durch Verhaltensprobleme einerseits aus dem Bereich unaufmerksamen Verhaltens und andererseits durch übermäßiges hyperaktiv-impulsives Verhalten. Dabei zeigt sich die Unaufmerksamkeit der betreffenden Kinder in der Weise, dass es ihnen zum einen nicht möglich ist, in Anforderungssituationen eine ausreichende Ausdauer aufzubringen (eingeschränkte Daueraufmerksamkeit) und zum anderen eine Konzentration auf die spezifischen Anforderungen in einer Situation nur unzulänglich gelingt, da die Kinder sehr sensibel auf Störreize reagieren (erhöhte Ablenkbarkeit). Dieses Problemverhalten manifestiert sich vor allem in Anforderungssituationen, die nicht selbst motiviert sind, sondern von außen an die Kinder herangetragen werden. Dies ist im Schulleistungskontext der Fall, wenn die Kinder im Unterricht oft nicht sitzen bleiben können, dazwischen rufen, andere unterbrechen und Aufgaben nicht geordnet angehen und nicht konzentriert (planvoll-reflexiv) bei der Sache bleiben können. Große Probleme zeigen sich zudem in komplexeren sozialen Situationen. Hier weckt das unaufmerksame und sprunghafte Verhalten des Kindes oft Unmut und wird von Gleichaltrigen sowie von Erwachsenen als sehr störend erlebt, so dass die betreffenden Kinder oft abgelehnt werden und häufig soziale Ausgrenzung erfahren.
Probleme vor allem bei Fremdmotivation
Das sekundäre Symptomspektrum umfasst eine beträchtliche Bandbreite komorbider Verhaltens-, Erlebens- und Leistungsprobleme. So belegen Metaanalysen von Subgruppenstudien, dass 30 bis 90 Prozent hyperkinetischer Kinder differenzialdiagnostisch gleichzeitig als dissozial klassifiziert werden können. Zudem leiden wahrscheinlich bis zu 85 Prozent hyperaktiver Kinder unter zusätzlichen affektiven Störungen. Im Einzelnen weisen ein Drittel der HKS-Kinder depressive Neigungen auf, und bei über einem Viertel der Kinder sind zusätzliche Angststörungen festzustellen. Des Weiteren haben 80 bis über 90 Prozent aller hyperaktiven Kinder Lernschwierigkeiten in Form einer fächerübergreifenden Schulleistungsproblematik. 23 bis 35 Prozent hyperaktiver Kinder sind Klassenwiederholer (vergleiche Linderkamp, 1996).
Insbesondere diese sekundären beziehungsweise Folgeprobleme der betreffenden Kinder erhöhen das Risiko der Stabilisierung und Chronifizierung über das Kindes- und Jugendalter hinaus bis ins Erwachsenenalter. Entsprechend dokumentieren Längsschnittuntersuchungen, dass etwa 60 Prozent der betroffenen Kinder auch noch als Erwachsene Symptome einer HKS aufweisen. Zudem wurden in erhöhtem Ausmaß antisoziale beziehungsweise delinquente Verhaltensweisen, wenige beziehungsweise konfliktreiche Sozialbeziehungen sowie Drogenmissbrauch bei heranwachsenden hyperaktiven Kindern festgestellt (vergleiche Naumann, 1996).
Was die Ätiologie bei HKS betrifft, so sind sowohl biologisch-dispositionale als auch psychosoziale Faktoren anzuführen.
Ergebnisse psychobiologischer Forschung führen die mangelnde Selbststeuerungsfähigkeit hyperaktiver Kinder auf eine defizitäre Regulation im noradrenergenen System des ZNS zurück. Ursächlich hierfür sind zum einen unspezifische prä-, peri- und postnatale und in nicht unerheblichem Ausmaß genetische Faktoren. Hereditätsstudien weisen hier ein fünffach erhöhtes HKSRisiko für Kinder hyperaktiver Eltern auf (vergleiche Samudra & Cantwell, 1999). Als weitere bedeutsame Größen gelten psychosoziale Faktoren. So liegt häufig eine beeinträchtigte Eltern-Kind-Beziehung vor, die durch eine verstärkte Anwendung bestrafungsorientierter Erziehungspraktiken, vermehrte Unsicherheit und Selbstkritik sowie weniger Gelassenheit und Souveränität in der Erziehung gekennzeichnet ist (siehe Saile & Gsottschneider, 1995).
Diagnostische Kriterien:Zu bedenken ist an dieser Stelle, dass sowohl unaufmerksames Verhalten, wie hohe Sensibilität für externe Reize und Ungeduld, als auch motorische Unruhe und Impulsivität gleichsam ein Kennzeichen gesunden kindlichen Verhaltens darstellen können, wenn es im Sinn wissbegierigen Lerninteresses oder intensiven explorativen Spielverhaltens interpretiert werden kann. Unter diesen Umständen kann ein solches Verhalten durchaus als sehr positiv im Sinn von „antriebsstark” und „aufgeweckt” wahrgenommen werden.
Zudem besteht aktuell das Problem der Fehldiagnose, indem im Zuge des derzeitigen starken öffentlichen Interesses an der Problematik des „Zappelphilipps” vorschnell ein diagnostisches Urteil gefällt wird. Daher ist hervorzuheben, dass eine klinische Problematik erst dann gegeben ist, wenn neben den
• charakteristischen Verhaltensmerkmalen für Unaufmerksamkeit (mangelnde Ausdauer, geringe Vorausplanung, mangelnde Sorgfalt, Abgelenktheit), Impulsivität (mit Antworten herausplatzen, andere stören und unterbrechen) und Hyperaktivität (extensiver Bewegungsdrang)
• die Verhaltensäußerungen im Vergleich zu Kindern mit gleichem Entwicklungsstand in deutlich stärkerer Ausprägung sowie
• situationsübergreifend (zum Beispiel zu Hause und in der Schule) vorliegen und dabei
• einen deutlichen Leidensdruck in den sozialen, schulischen oder beruflichen Lebenszusammenhängen des betroffenen Kindes oder Jugendlichen verursachen. Des Weiteren
• müssen die Verhaltensmerkmale seit mindestens sechs Monaten vorliegen sowie
• vor dem siebten Lebensjahr begonnen haben.
• Die Störung ist auszuschließen, wenn anderweitige schwerer wiegende Entwicklungsstörungen vorliegen und wenn das Störungsverhalten eher als reaktiv bedingt zu sehen ist; das Kind also auf relativ akute krisenhafte Lebensereignisse (Überforderung nach Umschulung, Trennung der Eltern und mehr) reagiert.
Diese Zuweisungsmerkmale finden sich in international gültigen Klassifikationssystemen wieder (ICD-10; DSM-IV) und sind mithin bindend für ein fachlich fundiertes diagnostisches Vorgehen (im Einzelnen vergleiche Lauth & Linderkamp, 1995).
Therapie/Intervention:
Unter Berücksichtigung der Behandlungsstandards der American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1991) ist bei Kindern und Jugendlichen mit HKS eine multimodale Therapiekonzeption angezeigt. Bei diesem Vorgehen kommen im Wesentlichen eine medikamentöse Behandlung und verhaltenstherapeutische Methoden beziehungsweise Konzepte zum Einsatz.
Die medikamentöse Behandlung erfolgt zumeist mit Stimulanzien (Methylphenidat – zum Beispiel Ritalin®) und stellt eine Maßnahme dar, die bei starker hyperaktiv-impulsiver Symptomausprägung indiziert ist, da sie sehr zur Entlastung des Kindes und der Familie führt. Auf Seiten des Kindes kann somit etwa eine drohende Sonderbeschulung abgewendet werden, innerfamiliär wird eine Eskalation beziehungsweise Chronifizierung der Beziehungskonflikte verhindert. Die Stimulanzientherapie ist bei 60 bis 90 Prozent der betreffenden Kinder wirksam, die Effekte sind umfassend und führen zur signifikanten Verbesserung sowohl der motorisch-impulsiven Symptomatik als auch des Aufmerksamkeitsverhaltens. Kontraindikationen liegen vor bei Tic- Störungen, herab gesetzter Hirnkrampfschwelle sowie bei Medikamentenabusus im Umfeld des Kindes. Bis auf eher geringe Schlaf- und Appetitstörungen und zum Teil anfänglichen Bauch- und Kopfschmerzen sind keine Nebenwirkungen bekannt. Bisherige Untersuchungen dokumentieren auch keine erhöhte Gefahr der Entwicklung einer Medikamentenabhängigkeit. Jedoch sind die Therapieeffekte begrenzt, denn es fehlen Generalisierungen auf die sozialen und Schulleistungsdefizite und auch Langzeiteffekte bleiben aus. Insofern handelt es sich bei der Stimulanzienverabreichung nicht um eine symptombezogene Heilbehandlung, sondern um eine Maßnahme zur Entspannung der Situation, ohne dass die Kinder jedoch einen Kompetenzgewinn erfahren. (siehe Fisher & Beckley, 1999). Es sind daher stets ergänzende therapeutische Maßnahmen angezeigt, um einen Kompetenzaufbau seitens des Kindes zu erreichen. Verhaltenstherapeutische Maßnahmen haben den Aufbau sozialer und kognitiver Fertigkeiten zum Ziel, die das Kind dabei unterstützen, sein Verhalten besser zu steuern und zu organisieren (Linderkamp, 2001; Lauth & Schlottke, 1999).
Eltern müssen einbezogen werden
Ganz wesentlich ist dabei die Einbeziehung der Eltern und auch der Lehrer des Kindes. Entsprechende Elterntrainings (Döpfner et al., 1997) zielen darauf ab, Veränderungen hinsichtlich (häufig automatisierter) negativer Interaktionsmuster zu erzielen, indem die Erziehungskompetenz der Eltern gestärkt wird, um so das Verhalten des Kindes besser steuern zu können. Dabei werden mit den Eltern vor allem Verhaltensmuster positiver sozialer Verstärkung (wie Zuwendung bei ausdauerndem Spiel) aber auch spezielle operante Methoden (wie Token- System) eingeübt. Im Rahmen einer Beratung weiterer Bezugspersonen wird praktisches Wissen über das Störungsbild vermittelt, so dass es möglich wird, positive Interaktionen mit dem hyperaktiven Kind anzubahnen sowie angemessenes Verhalten des Kindes gezielt zu verstärken. Dies ist sowohl für permanente Bezugspersonen wie Lehrer und Erzieher als auch für kurzzeitig zuständige Personen (zum Beispiel Ärzte, Zahnärzte) von Relevanz.
Störungshintergrund bei HKS
• Das „überdrehte Verhalten” der Kinder ist nicht selbst gewählt und auch kein Ausdruck „freudiger Erregung”, sondern steht für eine elementare Selbststeuerungsproblematik.
• Daher besteht auf Seiten des Kindes kein „böser Wille“; das Kind selbst leidet massiv unter seinem Steuerungsproblem (auch wenn dies im Kontakt mit dem „überdrehten“ Kind oft schwer zu erkennen ist).
• Das Kind kann Situationen häufig nicht richtig einschätzen; ist daher erhöht unfallgefährdet.
• Hinter einer „großen Klappe” verbergen sich große soziale Unsicherheit, Ängstlichkeit und weitreichende Selbstwertprobleme – insofern besteht ein großer Unterstützungsbedarf.
• Es besteht ein sehr großer Bedarf nach Anerkennung.
• Es liegt auf Seiten des Kindes eine zumeist wenigstens durchschnittliche Intelligenz und oft ein großes kreatives Potenzial vor.
Angemessenes Verhalten bei HKS
• Gelassenheit und Souveränität sind die Voraussetzungen, damit Sie Kontrolle über die Situation erhalten und sie behalten.
• Seien Sie dem Kind positiv zugewandt, unterstellen Sie ihm (auch non-verbal, zum Beispiel mimisch) keine böse Absicht.
• Auch wenn das Kind sie einer harten Prüfung unterzieht: bleiben Sie „stur liebenswürdig”.
• Im Umgang mit dem Kind ist ein hohes Maß an Strukturierung notwendig.
• Sagen Sie dem Kind gleich zu Anfang genau, was Sie in welcher Abfolge in welchem Zeitrahmen vorhaben.
• Sprechen Sie das Kind viel an.
• Seien Sie dem Kind permanent zugewandt und nehmen Sie zum Zweck der Aufmerksamkeitslenkung auch durchaus kurzen Körperkontakt (Oberarm, Schulter) mit dem Kind auf.
• Wenn das Kind unerlaubt Dinge nimmt: nehmen Sie dem Kind die Dinge emotionsund wortlos wieder ab.
• Keine negativen Prophezeiungen („So wird das NIE was!”) oder generalisierte Anklagen („IMMER musst Du hier herumtreten!”).
• Keine Moralisierungen („So etwas tut man aber nicht!”).
• Keine Diskussionen und langwierigen Verhandlungen mit dem Kind.
• Geben Sie statt dessen sachliche klare, kurze Anweisungen.
• Ignorieren Sie so weit es geht das permanente Gerede des Kindes – inklusive möglicher verbaler Provokationen und Beleidigungen.
• Wenn es zu heftig wird: Nutzen Sie sprachlich unterstütze Gesten: Das Kind fest (aber nicht böse) anschauen, die flache Hand „bremsend” hochheben und deutlich „Stopp!” sagen.
• Sagen Sie in kurzen, klaren Sätzen, was SIE möchten ("Ich-Botschaften”); nicht: "Lass das!” sondern: "Ich möchte, dass du deine Hände auf deine Beine legst!”
• Bleiben Sie „eng am Kind”, halten Sie so oft wie möglich (freundlichen) Blickkontakt.
• Drohen Sie dem Kind nicht.
• Kleine Störungen sollten ignoriert werden.
• Auf größere Störungen gelassen aber konsequent korrigierend reagieren. Dabei
• keine Ermahnungen und Appelle, sondern:
• sprechen Sie das Kind direkt und unaufgeregt an, dass Sie um seine Probleme still zu sitzen wissen und arbeiten Sie auf diesem Hintergrund mit Belohnungen: „Ich weiß, dass Du nicht so gut still halten kannst und deshalb biete ich Dir an, dir immer eine Münze/zehn Pfennig (oder einen Gummibär oder Ähnliches) zu geben, wenn Du es schaffst, bis der Zeiger der Uhr an der Wand ein mal ‘rum ist, still zu sitzen (oder den Mund offen zu halten oder Ähnliches).” Wenn das Kind es schafft, loben Sie es sehr und fahren Sie so fort („Ein Wettbewerb ums still Sitzen”). Bereiten Sie dieses „Spiel” mit dem Kind gegebenenfalls bereits telefonisch mit der Mutter vor.
• Das Kind erlebt selten Erfolge. Also: Loben Sie das Kind von Beginn an und zwar auch für kleine Erfolge – zum Beispiel wenn es dem Kind gelungen ist an einem (kurzen) Stück den Mund offen zu halten.
• Schließlich: Auch die Mütter der Kinder brauchen viel Zuspruch, denn sie fühlen sich zumeist recht hilflos und (erziehungs-) unsicher, werden häufig kritisiert und erleben soziale Ausgrenzung. Daher ist es angezeigt, sensibel für positive Aspekte im Verhalten des Kindes und der Mutter zu sein und diese Beobachtungen auch (verstärkend) zurückzumelden.
Dipl.-Psych. Dr. Friedrich LinderkampUniversität DortmundFakultät Rehabilitationswissenschaften/RehabilitationspsychologieZentrum für Beratung und TherapieEmil-Figge-Straße 50D-44221 DortmundE-Mail:friedrich.linderkamp@uni-dortmund.de