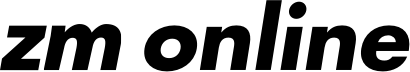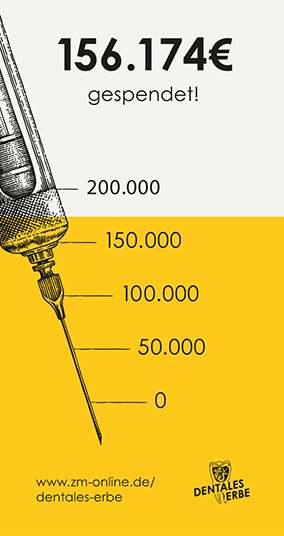Psychologische Aspekte des Alterns
Ganz explizit fokussiert der Beitrag das hirnorganisch gesunde Altern. Diese Form des Alterns stellt bis in das Alter der Hochbetagten (über 90-Jährigen) die Normalform des Alterns dar (Abbildung 1).
Methoden der Entwicklungsforschung
Bevor man sich mit den Ergebnissen der Alternsforschung vertraut macht, ist es wichtig, einige methodische Hintergründe zu verstehen, über die sich auch manch widersprüchlicher Befund erklären lässt. Grundsätzlich stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, altersassoziierte Veränderungen zu analysieren: die Längsschnitt- und die Querschnittuntersuchung. Während bei der Querschnittuntersuchung zu einem Zeitpunkt verschiedene Altersgruppen untersucht und miteinander verglichen werden, wird bei einer Längsschnittuntersuchung ein und dieselbe Kohorte über mehrere Jahre, in sehr seltenen Fällen sogar Jahrzehnte begleitet. Ein Großteil früher Befunde zur Alternsforschung entstammt Querschnittsuntersuchungen. Diese Untersuchungen haben den erheblichen Nachteil, dass altersassoziierte Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen möglicherweise mehr ein Effekt der unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen verschiedener Generationen sind, als altersbedingte Veränderungen darzustellen. Abbildung 2 verdeutlicht, welche Verzerrungen hierdurch entstehen können. Obwohl in allen vier abgebildeten Generationen längsschnittlich betrachtet ein Anstieg der betreffenden Fähigkeit bis zum Alter von 20 Jahren verzeichnet werden kann, um dann ein stabiles Niveau zu erreichen, entsteht aufgrund der Generationenunterschiede im Querschnitt der Eindruck eines altersbedingten Abfalls der betreffenden Messwerte. Eine weitere Interpretationsschwierigkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass sich mit dem Alter auch Populationsveränderungen ergeben. In der Gruppe der 65-Jährigen sind eben nicht mehr alle Personen des betreffenden Geburtsjahrgangs vertreten, da einige gestorben, zur Teilnahme an Untersuchungen nicht mehr fähig, verzogen und mehr sind. Man muss davon ausgehen, dass solche Populationsveränderungen nicht unsystematisch erfolgen, sondern der Effekt bestimmter Randbedingungen sind, die sich dann ebenfalls verzerrend auf die altersassoziierten Daten auswirken können. Abbildung 3 veranschaulicht dieses Phänomen für ein fiktives Beispiel, bei dem systematisch die Personen mit den niedrigsten Messwerten aus der Population ausscheiden. Betrachtet man hier die Mittelwerte, entsteht der Eindruck einer altersbedingten Zunahme der Messwerte. Dieser verzerrende Effekt selektiver Populationsveränderungen kann in Längswie in Querschnittsuntersuchungen gleichermaßen auftreten. Ganz allgemein gilt: Eine wissenschaftliche Analyse altersbedingter Veränderungen ist mit einer hohen Interpretationsunsicherheit verbunden. Da wir das Alter der Personen nicht im randomisierten kontrollierten Versuch zuweisen können, können wir nie sicher sein, ob nicht andere Faktoren als das Alter für die beobachteten Altersunterschiede verantwortlich sind. Einig ist man sich allerdings heute in der entwicklungspsychologischen Forschung, dass längsschnittliche Analysen querschnittlichen Daten vorzuziehen sind, da sie eine eindeutigere Interpretation erlauben. Zugleich sind gute längsschnittliche Studien naturgemäß aufgrund des hohen Untersuchungsaufwandes eher selten. Soweit wie möglich referiert der vorliegende Artikel solche längsschnittlichen Daten.
Veränderungen der Intelligenz
Gerade auf der Basis erster querschnittlicher Untersuchungen zur Entwicklung der Intelligenz entstanden in der frühen Entwicklungspsychologie des Alterns die sogenannten Defizitmodelle des Alterns. Diese gehen davon aus, dass im Alter nicht nur mit einem Abbau körperlicher Fähigkeiten, sondern auch mit psychischem Abbau gerechnet werden muss. Neuere Untersuchungen zeigen allerdings, dass sich dann kaum mehr eindeutige altersassoziierte Intelligenzeinbußen dokumentieren lassen, wenn Entwicklungen längsschnittlich untersucht und außerdem Faktoren wie Bildung oder eine spätere Demenz kontrolliert werden. Auffällig sind dagegen veränderte Entwicklungsverläufe in unterschiedlichen sozialen Schichten. Diese deuten darauf hin, dass einem altersassoziierten Intelligenzverlust möglicherweise bestimmte, mit der sozialen Schicht verbundene Faktoren vorbeugen, wie beispielsweise eine höhere kognitive Aktivität oder höhere kognitive Anforderungen, denen Personen höherer sozialer Schichten möglicherweise ausgesetzt sind. In jedem Fall sprechen die Schichtunterschiede im Entwicklungsverlauf dagegen, Intelligenzverluste im Alter ohne weiteres als altersbedingt zu interpretieren.
Dass man im Alter vergesslich wird, ist eine weit verbreitete Annahme. Ganz sicher gilt dies bei demenziellen Erkrankungen, die im Alter gehäuft auftreten. Von einem allgemeinen Abbau von Gedächtnisleistungen im Alter (der also die unterschiedlichen Gedächtnisleistungen gleichermaßen betrifft) kann aber noch nicht einmal mehr bei Demenzerkrankungen ausgegangen werden, erst recht nicht im Falle des hirnorganisch gesunden Alterns. Statt dessen zeigen verschiedene, hier allerdings fast immer querschnittliche, Analysen, dass das Alter als erklärender Faktor in den Hintergrund tritt, wenn andere Faktoren kontrolliert werden, wie eine veränderte Verarbeitungsgeschwindigkeit, Begabung, Übung, Gesundheit, Motivation. Die meisten Studien, die altersassoziierte Gedächtnisveränderungen analysieren, vergleichen Senioren mit Studierenden. Es liegt auf der Hand, dass diese beiden Gruppen sich nicht nur im Alter, sondern auch hinsichtlich der Anforderungen unterscheiden, die alltäglich an ihr Gedächtnis gestellt werden. Während bei alten Menschen viele Prozesse bereits automatisiert sind und damit der Erwerb neuer Gedächtnisinhalte nur noch wenig geübt wird, stehen Studierende in der Pflicht, eben dies tagaus tagein zu tun. Und tatsächlich zeigt sich, dass bei Älteren erhebliche kognitive Reserven mobilisiert werden können, die dazu beitragen können, dass ihre Gedächtnisleistungen denen Junger gleichwertig, gelegentlich sogar überlegen sind. So haben Ältere häufig per se zunächst eine schlechtere Lerntechnik als Junge und profitieren besonders von einer Strukturierung der Lerninhalte und der Vermittlung von Mnemo-Techniken. Interessant sind auch Daten, die eine große Diskrepanz zwischen den im Labor untersuchten Gedächtnisleistungen und den Gedächtnisleistungen im Alltag dokumentieren. So zeigen ältere Personen im Alltag bessere prospektive Gedächtnisleistungen, das heißt sie halten beispielsweise besser Termine ein, erinnern sich besser an Dinge die noch zu tun sind, als Junge. Im Labor dreht sich dieser Effekt um. Dies ist ein Hinweis darauf, dass gerade bei Gedächtnisleistungen die motivationale Komponente eine erhebliche Rolle spielen könnte. Auch durch alleiniges Ermutigen Älterer hinsichtlich ihrer Gedächtnisfähigkeiten können bereits erhebliche Effekte auf die nachfolgende Leistung erreicht werden. Unabhängig davon muss berücksichtigt werden, dass Ältere mehr Zeit für die Informationsaufnahme benötigen und offensichtlich weniger bereit, möglicherweise auch in der Lage sind, kognitive Energien für komplexe Gedächtnisprozesse zur Verfügung zu stellen. Auch zeigen sie sich beim Lernen störanfälliger als Junge. Schließlich sollte bedacht werden, dass Gedächtnisleistungen und -einschränkungen in unterschiedlichen Gedächtnisdomänen auch sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können. Soweit altersassoziierte Veränderungen beobachtet werden, betreffen sie nicht alle Bereiche der Gedächtnisleistung gleichermaßen.
Allgemein wird heute bei den beiden kognitiven Leistungsanteilen, Intelligenz und Gedächtnis, davon ausgegangen, dass altersassoziierte Veränderungen weniger veränderten Fähigkeiten und mehr einer veränderten Motivation älterer Personen, verändertem Training, aber auch veränderten Zielsetzungen zuzuschreiben sind. So geht man davon aus, dass die selbst eingeschätzte verbleibende Lebenserwartung in erheblichem Maße die persönlichen Investitionen in verschiedene Leistungsbereiche mit bestimmt. Wer nicht damit rechnet, dass er neu erworbenes Wissen noch wird anwenden können, ist auch zum Neuerwerb weniger zu motivieren.
Veränderungen der Persönlichkeit beim Altern
In der heutigen Persönlichkeitsforschung geht man davon aus, dass sich die Persönlichkeit eines Menschen entlang von fünf Dimensionen beschreiben lässt: Extraversion (gesprächig, energiegeladen, bestimmt), Verlässlichkeit (verlässlich, mitfühlend, freundlich), Gewissenhaftigkeit (organisiert, verantwortungsbewusst, vorsichtig), emotionale Stabilität (stabil, ruhig, zufrieden), Offenheit für Erfahrungen (zum Beispiel kreativ, intellektuell, offen). Diese fünf Dimensionen der Persönlichkeit bleiben bis ins hohe Alter nachweisbar. Es kommt also nicht zu einer Aus- oder Entdiffenzierung der Persönlichkeit. Weiterhin bleiben diese Persönlichkeitsmerkmale in hohem Maße stabil über die Zeit und zwar sowohl was das Verhältnis zu Gleichaltrigen betrifft (wer im Alter von 20 als besonders gewissenhaft auffiel, wird voraussichtlich auch im Alter von 80 zu den gewissenhafteren seiner Altersgruppe gehören). Auch bleiben die Auslenkungen über die Zeit in etwa die gleichen, das heißt, man bewegt sich über die Lebensspanne in etwa auf gleichem Niveau hinsichtlich der verschiedenen Persönlichkeitsmerkmale. Gerade die neueren Wachstumstheorien des Alterns legen nahe, dass es hinsichtlich bestimmter Persönlichkeitsmerkmale sogar zu Gewinn und Wachstum kommt, beispielsweise bei der Selbst- und Emotionsregulation.
Auch hinsichtlich des nächsten wichtigen psychologischen Bereichs, den Emotionen, lassen sich keine Defizite mit dem Alter erkennen. Eher scheint es so zu sein, dass ältere Personen ein komplexeres Emotionsempfinden haben als jüngere, auch wenn sie möglicherweise zu einem verstärkten Verbergen von Emotionen neigen. Zugleich verfügen sie oft über eine stärkere Emotionskontrolle und investieren auch mehr Energien in diese, beispielsweise um trotz objektiver Einschränkungen eine positive Affektivität zu stützen. Physiologisch weisen sie denn auch eher geringere emotionsspezifische Reaktivitäten auf, zeigen weniger Angstreaktionen auf vergleichbare Stimuli und vor allen Dingen auch weniger Angst vor dem Tod als Personen im mittleren Erwachsenenalter. Die Rahmenbedingungen des Alterns sind allerdings oft begleitet von einer stärkeren Vereinsamung der Personen, die gelegentlich als eine Ursache altersassoziierter depressiver Erkrankung interpretiert wird. Eine differentialdiagnostische Abgrenzung von kognitiven Defiziten, die auf eine beginnende Demenzerkrankung, auf eine Depression oder auf allgemeine Alterungsprozesse zurückgeführt werden, ist für die adäquate Behandlung der betroffenen Person von größter Bedeutung.
Fazit I: Alter als Psychodiagnose
Betrachtet man die vier genannten wichtigen Bereich der Psyche, kognitive Leistungsfähigkeit, Gedächtnis, Persönlichkeit, Emotionen, und die vorliegenden Befunde zur altersassoziierten Veränderung so scheint eines gewiss: Alter ist keine Psychodiagnose! Auf der Basis des Alters lassen sich also die psychologischen Eigenschaften eines Menschen nicht vorhersagen. In der Tat zeigen sämtliche Befunde, dass die Unterschiede innerhalb einer Altersgruppe um ein vielfaches größer sind als die Unterschiede zwischen Altersgruppen. In den kognitiven Leistungsbereichen Intelligenz und Gedächtnis ergeben sich zudem geringe Assoziationen mit dem chronologischen Alter, wenn Umwelt, Bildung, Komplexität des Arbeitsplatzes, persönliche Interessen und mehr kontrolliert werden. Bis ins hohe Alter kann eine hohe behaviorale aber auch neuronale Plastizität nachgewiesen werden, die zu dem englischen Bonmot „Use it or lose it“ geführt hat. Es scheint die Verwendung kognitiver Kapazitäten zu sein, ihr regelmäßiges Training, das wesentlich mehr über den Entwicklungsverlauf aussagt als das chronologische Alter. Soweit sich Defizite im Alter feststellen lassen, sind sie häufig mit einer späteren Demenz oder einer aktuellen Depression assoziiert. Bei allen Analysen auch beim Umgang mit alten Personen muss auch berücksichtigt werden, dass sich deren Zielsetzungen und Motivationslagen ganz grundlegend von denen jüngerer unterscheiden können, was sich dann eben auch im Investment für verschiedene Aufgaben und Anforderungen niederschlägt. Deutliche körperliche und soziale Veränderungen tragen hierzu das Ihre bei. Auf der Basis des Vorgenannten nimmt die heutige Entwicklungspsychologie die Entwicklung im Alter zunehmend auch als einen intentionalen, vom Individuum selbst gesteuerten Vorgang wahr. Dabei stellt das höhere Lebensalter besondere Anforderungen, die sich auch als Entwicklungsaufgaben formulieren lassen, die nicht nur im höheren Lebensalter bestehen. Nach dieser Auffassung wird eine Entwicklung immer dann erfolgreich im Sinne von hohem Wohlbefinden sein, wenn es gelingt, sich stets neu an sich verändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Dabei werden die eigenen Zielsetzungen überdacht und im Bedarfsfall auch modifiziert. Unabwendbar sind für die meisten Älteren Veränderungen der körperlichen Funktionstüchtigkeit, verschiedener Umweltfaktoren (wie Mobilität, Wohnlage), der sozialen Rahmenbedingungen (wie veränderte Rollen, Verlust von Netzwerkpartnern). Allein hier ist bereits eine erhebliche Anpassungsleistung zu vollbringen. Maßgeblich für den Anpassungserfolg ist eine realistische Einschätzung des jeweils Erreichbaren und damit auch eine flexible Anpassung jeweiliger persönlicher Ziele an diesen Rahmen.
Fazit II: Konsequenzen für die zahnärztliche Praxis
Welche Konsequenzen ergeben sich nun für den Umgang mit älteren Patienten in der zahnärztlichen Praxis? Zunächst gilt es zu akzeptieren, dass das chronologische Alter keinerlei Vorhersage über psychische Grundfunktionen erlaubt. Man wird also nicht umhin kommen, sich mit der Individualität des einzelnen alten Menschen ganz genauso wie mit der Jüngerer auseinanderzusetzen.
Neurologische Veränderungen in der Informationsverarbeitung, die beispielsweise die Verarbeitungsgeschwindigkeit betreffen können, sollten bei der Behandlung und Beratung Älterer mit bedacht werden. Auch dürften gerade Ältere von einer guten Strukturierung und einer gelungenen didaktischen Aufbereitung zahnärztlich zu vermittelnder Informationen profitieren (die allerdings Jüngeren auch nicht vorenthalten werden sollte). Eine jüngst publizierte Studie zum parodontitisrelevanten Wissen in der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland [Deinzer et al., 2009] zeigt ein erstaunliches Resultat. Obwohl Parodontalerkrankungen in der Gruppe der Senioren deutlich häufiger auftreten als im mittleren Erwachsenenalter [Hoffmann, 2006] und obwohl Aufklärung und Motivation ein fester Bestandteil der Parodontitisbehandlung sind, sind Senioren über Parodontitis deutlich schlechter informiert als jüngere Erwachsene. Dieser Effekt lässt sich nicht einfach über mögliche kognitive Einbußen erklären, zeigt er sich doch unabhängig von der Schulbildung der Betroffenen. Plausibler ist hier die Annahme, dass ein Defizit in der Aufklärungsarbeit mit älteren Patientinnen und Patienten zugrunde liegt, das in der Zukunft überwunden werden sollte.
Als eine wesentliche Hilfe bei der Erreichung der Entwicklungsaufgabe der flexiblen Zielanpassung können realistische Zielvorgaben ärztlicherseits wirken. So kann es für eine alternde Person hilfreicher sein, realistisch darauf vorbereitet zu werden, dass sie nie wieder so wird kauen können wie vor 30 Jahren, als ihr eben dies in dem Wunsch, sie zu ermutigen, zu versprechen und damit die Anpassung an die veränderten oralen Bedingungen zu erschweren.
Zusammenfassung
Alter ist keine Psychodiagnose. Hierauf deuten Befunde der Intelligenz-, Gedächtnis-, Persönlichkeits- und Emotionsforschung hin. Vielmehr gilt auch im Alter, dass Entwicklungen höchst individuell verlaufen und verschiedenen Einflussfaktoren jenseits chronologischer Alterungsprozesse unterliegen.
Prof. Dr. Renate DeinzerInstitut für Medizinische PsychologieFB 11 – Justus-Liebig-Universität GießenFriedrichstraße 3635392 Gießenrenate.deinzer@psycho.med.uni-giessen.de