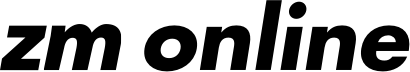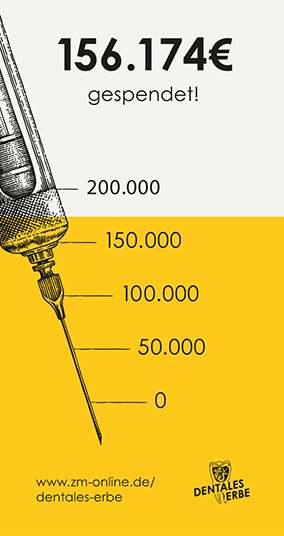Die Kunst ein guter Zahnarzt zu werden
„Die Zahnheilkunde ist fließend“, bemerkte Walther einführend. Ständig gebe es Neuigkeiten, ständig Innovationen, die begleitet, bewertet und deren für gut befundene Errungenschaften an den Patienten weitergegeben werden müssen. Und hierzu zähle längst nicht mehr nur eine gute zahnmedizinische Fachausbildung, sondern beispielsweise auch das Leitbild einer perfekten Kommunikation mit dem Patienten. Vor diesem Hintergrund stellte Walther den Referenten aus verschiedenen zahnmedizinischen Disziplinen die Frage, wie sie es denn geschafft haben, „ein wirklich guter Zahnarzt zu werden“. Alle Referenten sind Menschen, die erst während ihrer Berufslaufbahn einen Weg gefunden haben, ihrer Profession und vor allem ihren Patienten gerecht zu werden.
Schnell, preiswert, und doch natürlich-ästhetisch
Als erster stellte Prof. Dr. Bernd Klaiber, inzwischen Emeritus aus Würzburg und Doktorvater von Walther, vor, was es für ihn bedeutet, ein guter Zahnarzt zu sein. Klaiber präsentierte Abbildungen von Falldarstellungen aus einer Zeit, als es noch nicht so perfekte zahnfarbene Materialien gab. Er zeigte, dass man Ende der 80er durchaus glücklich darüber war, einen verunfallten und abgebrochenen oberen Inzisivus mit einem Stift zu versorgen. „Heute“, so der Referent, „kleben wir ihn einfach wieder an. Und wenn das Bruckstück direkt nach der Behandlung viel heller aussieht, dann setzen Sie den Patienten eineinhalb Stunden ins Wartezimmer und geben ihm danach nochmals den Spiegel. Denn dann ist die Zahnfarbe perfekt. Die Helligkeit liegt daran, dass das Bruckstück ausgetrocknet ist! Erst die Durchfeuchtung macht die Translumineszenz. Das wissen wir heute!“ Während es früher sehr schwierig gewesen sei, schwarze Dreiecke oder ein Diastema zu schließen (Klaiber: „Das ging nur mit Veneers oder gar Kronen!“) nimmt man heute Komposit und modelliert sauber die Dreiecke zu oder verbreitert den einen oder anderen Nachbarzahn. Und alles in einer Sitzung! „Das hätte ich mich früher nie getraut, heute ist es aber viel billiger, so zu arbeiten, schneller und damit auch viel effizienter für den Patienten!“
„Machen Sie sich klar, welche Zahnkonturen ein natürlicher Zahn hat. Diese gilt es ganz genau nachzubauen. Früher hatte man andere Möglichkeiten und Visionen. Wie häufig sieht man Zähne, also ’reparierte’, die eigentlich gar nicht für diese Position geeignet sind“, erklärte der Referent. „Erst wenn im Gesicht durch eine völlig unsichtbare Zahnbehandlung Harmonie erzielt wird, dann handelt es sich um eine wirklich gute Zahnbehandlung und damit auch um einen guten Zahnarzt“, postulierte Klaiber. „Wenn Sie sich mal umschauen, überall heißt es ’noch heller, noch brillianter, noch gleichmäßiger’, aber das ist nicht das Leben! Und wenn ein Zahnarzt sich auf diese Wünsche der Patienten einlässt, dann ist er eben kein guter Zahnarzt“, provozierte er und zeigte eine Reihe von Werbebeispielen, die die Patienten reihenweise in sogenannte „Ästethetikpraxen“ trieben. „Vergessen Sie nicht, wir sind Zahnärzte, das gilt es immer zu bedenken!“
Sicherheit für den Umgang mit dem Skalpell
Prof. Dr. Margrit-Ann Geibel, Ulm, demonstrierte dem Karlsruher Publikum, wie man lernt, ein besonders guter Operateur zu sein. Hierzu verwendet sie seit vielen Jahren erfolgreich die sogenannte Peyton-Methode.
„Das Verfahren ist relativ einfach“, erklärt sie. „Der Operateur führt einen bestimmten Eingriff in der für ihn üblichen, schnellen Geschwindigkeit vor, ohne dabei weitere Erklärungen abzugeben. Dann wiederholt er den Eingriff langsam und erklärt jeden Handgriff sehr genau. Daraufhin lässt er sich jedes Detail von dem Lernenden (Studenten oder Zahnarzt) genau repetieren und führt selbst nach dessen Anweisungen die zu erlernende Operation durch.“ So spiele der Student oder Zahnarzt quasi den Supervisor. Hiernach ist der „Neuling“ gefragt. Er muss mit seinen eigenen Erklärungen jetzt den Eingriff durchführen – unter Aufsicht des Ausbilders, versteht sich. Diese Methode, so Geibel, ermögliche es dem OP-Neuling, Sicherheit zu erlangen. Sie erklärte, warum gerade Frauen in der Oralchirurgie wenig anzutreffen sind. „Zwar haben wir weit über 60 Prozent Approbantinnen, aber immer noch gibt es eine Art Schwellenangst für das Fach Oralchirurgie.“ Sie erklärte dies auch damit, dass die chirurgische Ausbildung in einigen deutschen zahnmedizinischen Fakultäten hintangestellt wird und nur wenige Zahnkliniken ihre Studenten das Operieren lehren. Ihre vorgeführte Methode sei besonders darauf angelegt, Traumata, die unter Umständen in der studentischen Ausbildung erworben wurden, abzulegen und stattdessen eine Sicherheit zu geben, auch in schwierigen Situationen angstfrei „improvisieren“ zu können. Denn „in vielen Situationen kann man nicht nach dem Lehrbuch operieren, sondern muss situationsbedingt Entscheidungen treffen und einfach handeln“, so die Referentin. Sie erklärte, wie wichtig „die Sicherheit, mit dem Skalpell umzugehen“ sei, allein vor dem Hintergrund, angstfrei in den Notdienst zu gehen.
Weg mit der Angst vor der Angst
„Eigentlich wollte ich Psychologie studieren, aber meine Eltern sagten, mach was Vernünftiges. So kam ich zur Zahnmedizin.“ Mit diesen Worten begann PD Dr. Anne Wolowski, Münster, ihren beruflichen Werdegang zu schildern. Dass sie heute als „die Nachfolgerin von Müller-Fahlbusch“ gehandelt wird – und diesen Ruf durchaus verdient, ist einerseits dem Zufall, andererseits ihrem Interesse zu verdanken, den Patienten immer als ganzen Menschen zu sehen. Sie gab viele Tipps für den Umgang mit schwierigen Patienten, die nicht nur den Zahnarzt, sondern das ganze Team überfordern und dann den gesamten Praxisablauf durcheinanderbringen können. „Diese Hilflosigkeit, die der Behandler bei solchen Patienten verspürt, gilt es zu überwinden.“ Sie erklärte, warum Frauen als „schwierig“ gelten: weil sie einerseits ihre Konflikte, sprich Zahnbeschwerden oder Wünsche, bezüglich ihres Kauapparats viel häufiger äußern als Männer und weil sie – allein vor dem hormonellen Hintergrund betrachtet – ganz anders auf ihren Körper horchen und auch anders mit sich umgehen würden als das männliche Geschlecht. Der von dem Münsteraner Psychosomatik-Papst Prof. Dr. Hans Müller-Fahlbusch geprägte Begriff „Lehrerinnen mit Doppelnamen, Alter über 40“ sei auch heute noch gültig, so Wolowski. Aber es gelte nun, genau diese Patienten, die bereits mit einer Reihe von Live-Events und entsprechenden Problemen und Symptomen – wie unklarer Gesichtsschmerz, Bruxismus, Materialunverträglichkeiten, Gelenkprobleme und vieles mehr – den Weg zum Zahnarzt gefunden haben, bereits bei der Anmeldung „zu filtern“ und ihnen entsprechend zu begegnen. „Wenn ein Patient von seinem beschwerdezentrierten Leben berichtet, dann ist bereits aufzuhorchen“, sagte Wolowski. „Es gilt, den Patienten ernst zu nehmen“, forderte sie ein. „Machen Sie nie Feierabendtermine mit diesen Patienten!“ und „Planen Sie 30 Minuten ein und sagen Sie deutlich, wenn diese um sind, dann müssen Sie den Patienten wegschicken, damit er sie ernst nimmt!“
Ganz entscheidend sei, so Wolowski, dass der Patient Transparenz und Aufklärung in jeder einzelnen Behandlungsphase erhält. Sie rät: „Trainieren Sie Ihr Team auf die Erfassung auch der kleinsten Hinweise auf eine psychosoziale Beteiligung! Und: Bereiten Sie bereits in der Praxis alles vor, damit Sie einfach und gezielt eine interdisziplinäre, sprich psychosomatische Begleitung des Patienten in die Wege leiten können (Adressen von Fachleuten in der Nachbarschaft und mehr). Und: „Vergessen Sie nicht: Der Weg ist das Ziel!“
Die Perfektion im Verborgenen
„Ohne Lupenbrille und OP-Mikroskop brauchen Sie gar nicht erst anzufangen!“ Dr. Carsten Appel, Bonn, macht gleich von Anfang an klar, dass es etwas Besonderes ist, einen Zahn durch die Aufbereitung der Wurzel und ihrer diffizilen „Höhlenarme“ vor einer Extraktion und anschließendem Zahnersatz zu retten. Er erklärt, dass das Ziel einer Wurzelbehandlung die vollständige Entfernung aller Keime und Gewebereste sowie ein entzündungsfreier Verschluss sein muss. Somit seien immer wieder die Form, also die Anatomie des Wurzelkanals (-kanäle (WK)) sowie die Mikrobiologie die besonderen Herausforderungen, mit denen der Zahnarzt zu kämpfen hat. „Denken Sie daran, nicht immer ist der WK rund, meist ist er sogar länglich oval“, warnte Appel, „das gibt Probleme bei der vollständigen Aufbereitung.“ Sein Tipp: „Verwenden sie MTA (Mineralisches Trioxid-Aggregat) nur als Original, mit den Nachahmerprodukten gibt es nicht selten Probleme!“
Für ihn gibt es nur wenige Indikationen für eine Wurzelspitzenresektion: Dieses sind eine ganz besondere Krümmung des Kanals – er zeigte ein Röntgenbild mit einem etwa im 90 Grad-Winkel gebogenen WK – ein Pulpastein oder eine deutlich große Osteolyse am Apex. „Alle anderen Kanäle sollten aufbereitet werden“, postulierte er.
Zufrieden – und damit ein guter Zahnarzt in seinem Fachbereich sein – kann man seiner Meinung nach nur dann, wenn alle Wurzelkanäle aufgefunden, bis zum letzten Millimeter aufbereitet und alle Keime entfernt wurden, und wenn das Ganze dann noch perfekt gefüllt werden konnte, damit dem Patienten der Zahn für viele Jahre entzündungsfrei und damit beschwerdefrei erhalten werden konnte.