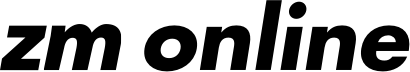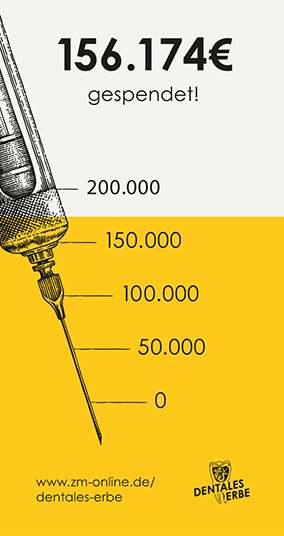Unkalkulierte Risiken
Am 10. Juli 1999 wurde im oberfränkischen Hirschfeld wieder einmal ein Windpark eröffnet: Getauft auf den Namen „Himmelreich“ wurde er jedoch für die Geldgeber alsbald zur Hölle. Rund 60 Anleger hatten knapp 700 000 Euro aufgebracht, um sich an der 2,2 Millionen Euro teuren Stromerzeugungsanlage aus Windkraft zu beteiligen. In Aussicht standen Steuereinsparungen bis zu 55 Prozent. Darüber hinaus sollte die Anlage eine fette Rendite abwerfen: Eine Einlage von 100 000 Mark sollte während der kommenden 20 Jahre insgesamt 130 Prozent Gewinn vor Steuern erbringen, also im Jahresschnitt 6,5 Prozent. Im Vergleich zu anderen Windkraftfonds eine recht unspektakuläre Renditerechnung.
Da der Staat die Abnahme der Windenergie zu einem Festpreis von bis zu 8,9 Cent pro Kilowattstunde garantiert, schienen die Windpropeller zur Stromerzeugung nicht nur ökologisch eine saubere, sondern auch ökonomisch eine sichere Sache zu sein. Die EU-Bürokratie hatte zwar die staatliche und steuerliche Subventionierung der Windkraftenergie angefochten. Aber der Europäische Gerichtshof (EuGH) gab am Ende sein Plazet. Das vermeintlich einzige Investorenrisiko war damit vom Tisch.
Doch schon bald wurden die Investoren vom Windpark „Himmelreich“ auf den Boden der Tatsachen zurückgerufen. Die Erträge ihrer Windmühlen deckten nicht einmal die laufenden Kosten. Die Folgen waren nach drei Jahren Verlustbetrieb von ganz irdischer Art: Der Windpark „Himmelreich“ ging im Oktober 2002 pleite. Das Anlagekapital der Investoren dürfte verloren sein. „Himmelreich“ war bestimmt nicht die letzte Insolvenz. „Es wird noch weitere Pleiten geben“, prognostiziert Stefan Loipfinger als neutraler und angesehener Experte für geschlossene Fonds.
Das unabhängige Hamburger Analysehaus FondsMedia nahm kürzlich rund 250 Windfonds im Hinblick auf ihre Rentabilität unter die Lupe. Das Ergebnis ist für die Investoren niederschmetternd: Etwa 75 Prozent aller Fonds erwirtschaften weitaus weniger Erträge als in den Prospekten ausgewiesen. Teilweise müssen an der Rendite Abstriche von 50 Prozent und mehr gemacht werden. Die großmäulig versprochenen Jahreserträge von acht bis zehn Prozent auf das eingesetzte Kapital erweisen sich zunehmend als Fantom. Die Folge: Die privaten Investoren, die seit 1998 insgesamt 1,5 Milliarden Euro auf Fondsbasis in Windkraftanlagen angelegt haben, können wohl über kurz oder lang ein Großteil davon in den Wind schreiben. (Die zm haben mehrfach vor Windkraft-Investments gewarnt.)
Die Fondsinitiatoren trösten die frustrierten Anleger derzeit mit dem fadenscheinigen Argument, in den letzten drei Jahren hätte der Wind weitaus schwächer geweht als im langjährigen Durchschnitt. Aber dieses Argument ist ebenso schwach wie angeblich der Wind. Denn bei den Windpropellern, die bereits vor dem Jahr 2000 ans Netz gegangen sind, ist – wahrscheinlich aufgrund der technischen Veralterung – die Energieausbeute noch geringer als bei den jüngsten Anlagen. Hinzu kommt, dass im Investitionsboom die für Windkraft geeigneten Standorte knapp geworden sind. So wurden auch an vielen Stellen mit weitaus weniger konstanten Winden als in den Küstenregionen neue Windpropeller errichtet.
Lahme Windflügel
Wer aufmerksam die Hügelketten der deutschen Mittelgebirge entlang fährt, stellt selbst als Laie schon bei bloßem Augenschein fest, dass sich viele Windflügel auch bei Wind nicht drehen. Sie sind meist aus technischen Gründen außer Betrieb. In der Regel ist nicht der fehlende Wind, sondern sind die Ausfallzeiten der stark reparaturanfälligen Kleinkraftwerke der Grund für die niedrigen Einnahmen aus dem Praxisbetrieb. Denn die Anlagen zur Erzeugung von Windkraftenergie sind technisch keinesfalls ausgereift und für den langjährigen Dauerbetrieb erprobt.
Weitaus häufiger als in den einladenden Zeichnungsprospekten kalkuliert, überhitzen die Minigeneratoren in den Drehflügelköpfen. Getriebe nutzen sich schneller ab als erwartet, Lager und Wellen halten den Naturkräften nicht Stand und bekommen Risse. Am empfindlichsten auf starken Wind reagieren die riesigen Rotorblätter. Sie müssen bei einem vertretbaren Kostenaufwand leicht und dennoch unverwüstlich sein. Beide Anforderungen sind wohl nur schwer in Einklang zu bringen.
Verschärfte Lage
Das Renditedebakel ist geradezu vorprogrammiert, wenn die Hersteller-Garantie abgelaufen ist, und die Versicherung gegen Betriebsunterbrechungen erstmals gekündigt hat. Die Kündigung der Versicherung erfolgt in der Regel recht rasch, da sich Sachversicherungen im Schadensfall immer das Recht vorbehalten, eine für sie verlustreiche Police zu beenden. Immerhin rund 40 Millionen Euro hatten die Versicherer im vergangenen Jahr für Betriebsunterbrechungen zu berappen. Da diese Summe bei weitem nicht die Prämieneinnahmen gedeckt hat, haben viele ihre Beiträge um bis zu 100 Prozent erhöht und so die Versicherungskonditionen verschärft.
Nun müssen sich immer mehr Windstromerzeuger verpflichten, ihre Anlagen rund um die Uhr unter fachkundige Aufsicht zu stellen. Diese Personalkosten waren bei den meisten Kalkulationen nicht eingeplant – jetzt zehren sie kräftig an der Rendite. Verschleiß-empfindliche Bauteile, so schreiben mittlerweile die Versicherungen vor, müssen spätestens alle fünf Jahre ausgetauscht werden. Und da sich in einem Windkraftwerk vor allem die Funktionsträger drehen, schrauben diese Auflagen die Wartungskosten in ursprünglich nicht kalkulierte Höhen. In den alten Renditerechnungen fehlt auch die Einschränkung der Versicherer, nicht mehr nach dem dritten Tag einer Betriebsunterbrechung für den Einnahmeausfall zu zahlen, sondern erst nach einer Woche Stillstand.
Fazit:Der private Investor, für den sich die Windmühle am grünen Tisch gerechnet hat, wird nun im realen Praxisbetrieb mit Kostenrisiken belastet, von denen im Prospekt und bei der Beratung nie die Rede war. Vielfach fehlte und fehlt in den Verkaufsprospekten sogar der banale Risikohinweis, dass mangels langjähriger Betriebserfahrung mit Windkraftwerken die Betriebs- und Wartungskosten eigentlich nicht für die vorgesehene Betriebsdauer von 20 Jahren kalkulierbar sind. Denn: Noch kein Windstromerzeuger hat bislang auf freiem Feld eine Dienstzeit von 20 Jahren oder gar länger absolviert.
Deshalb lohnt es sich für einen Windstrom-Anleger, seinen Prospekt auf fehlende Risikohinweise zu durchforsten. Damit sollte er sich nicht all zu lange Zeit lassen. Denn bereits drei Jahre nach dem Beitritt zu einem Windkraftfonds ist die Haftung für falsche oder fehlende Prospektangaben verjährt. Ein rechtskräftiges Urteil des Oberlandesgerichts Oldenburg gibt es bereits (Aktenzeichen 2U 190/02). Es bezieht sich darauf, dass im Prospekt des Fondsinitiators EBV von langjährigen erfolgreichen Windmes-sungen die Rede war. In Wirklichkeit aber dauerten die Windmessungen nur 13 Monate. Der klagende Fondsteilnehmer bekam seinen Einsatz in Höhe von 50 000 Euro zurück.
Renditeanreiz fehlt
Ansonsten aber bestehen kaum Hoffnungen, die gezeichneten Fondsanteile von Windparks weiter zu verkaufen. Sie sind „gebraucht“, weil sie von Anbeginn steuerlich verwertet wurden. Damit ist ein maßgeblicher Renditeanreiz bereits getilgt. Hinzu kommt, dass viele Fonds-Initiatoren ihre Anlagen mit bis zu 70 Prozent fremd finanziert haben, um durch die Zinsaufwendungen die steuerlich relevanten Werbungskosten für die Privatanleger hochzutreiben. Doch Zinsen sind Kosten. Und wenn diese am Strommarkt nicht oder nur mit Mühe verdient werden, kann allein schon aus diesem einfach kalkulierbaren Grund die Rendite nicht glänzen. Wer in seinem Anlageportfolio Wind gesät hat, wird sich wohl damit abfinden müssen, dass er auf seinem riskanten und wenig rentablen Fondsanteil bis zum bitteren Ende sitzen bleibt. Er wird also Sturm ernten – wie bei den Bauherrenmodellen und den Ost-Immobilien.