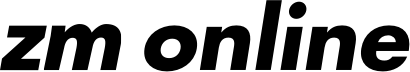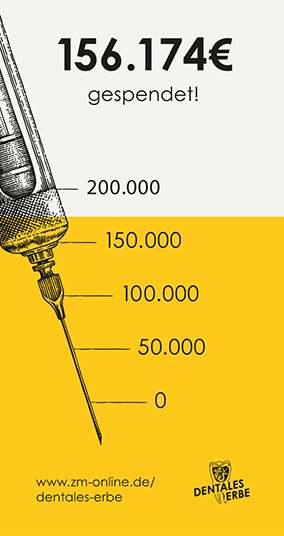Zwischen Zeitdruck und Versorgungsqualität
Ärzte und Zahnärzte werden im Laufe ihrer medizinischen Tätigkeit mit häuslicher Gewalt an Patientinnen konfrontiert. Diese liegt vor, wenn Frauen in ehelichen oder eheähnlichen Beziehungen körperliche, sexuelle oder psychische Gewalt erfahren. Mediziner sind sich bewusst, dass dies in Partnerschaften durchaus verbreitet ist und die Gesundheit in verschiedenster Weise beeinträchtigt. Oft fehlt ihnen jedoch das Wissen, wie Gewalt erkannt werden kann.
Einerseits sehen Ärzte und Zahnärzte sich selbst in der Verantwortung und betrachten es als ihre fachliche Aufgabe, die Versorgung von gewaltbedingten Verletzungen vorzunehmen. Andererseits wissen sie im konkreten Fall oft nicht, wie sie mit Patientinnen umgehen sollen, bei denen sie Gewalteinwirkungen vermuten.
Gesundheitsrisiko Gewalt
Die WHO zählt häusliche Übergriffe zu den zentralen Gesundheitsrisiken für Frauen und betont die kurz-, mittel- und langfristigen gesundheitlichen und psychosoziale Folgen, die eine besondere Herausforderung für Gesundheitsdienste und -berufe darstellen [Hellbernd/Wieners 2002].
Häusliche und sexualisierte Gewalt ist auch in Deutschland weit verbreitet, wie eine repräsentative bundesdeutsche Untersuchung aus dem Jahr 2004 zeigt. Aus den Daten ergibt sich, dass etwa jede vierte Frau in ihrem Erwachsenenleben mindestens einmal körperliche oder sexuelle Übergriffe durch einen Beziehungspartner erlebt hat [BMFSFJ 2004]. Im internationalen Vergleich unterscheiden sich die deutschen Ergebnisse nicht von denen anderer Länder [WHO 2002, Martinez et al 2006].
Als Folgen von häuslicher Gewalt weisen Frauen häufig Verletzungen im Kopf-, Gesichts- und Mundbereich auf. Diese sichtbaren Anzeichen erkennt der Zahnarzt am Stuhl, daher ist seine Praxis eine wichtige Anlaufstelle in der Gesundheitsversorgung. Internationalen Schätzungen zufolge weisen 88 bis 94 Prozent der betroffenen Frauen Verletzungen in dieser Körperregion auf [Hiesh et al., 2006; Ochs et al., 1996].
Typisch sind Zahn-, Mund- oder auch Kieferläsionen. Dazu zählen Verletzungen an der Lippe nach Schlag gegen den Mund oder Aufprall gegen eine harte Fläche, die zu Wunden oder Prellungen führen. Zudem sind blaue Flecken und Hämatome der Haut oder Ohren häufig, ebenso wie Augen mit subkonjunktivalen Hämatomen und Verletzungen der Zunge infolge eines Schlages gegen den Unterkiefer. Daneben gibt es auch Brüche des Nasenknorpels sowie schwere Kronen- und Wurzelfrakturen nach Gewalteinwirkung und Halsläsionen durch Würgen und Drosseln [Campbell et al., 2002; Rötzscher et al., 2008; Klopfstein et al., 2008].
Je nach Art und Schwere der Verletzung können Frauen dauerhaft in ihrer Seh- und Hörfähigkeit eingeschränkt werden. Gewalt und die damit stets verbundenen Beeinträchtigungen der körperlichen und sexuellen Integrität können zu Traumatisierungen führen. Diese zeigen sich auch darin, dass für die Betroffenen die Behandlung im Mundraum sehr stark mit Angst besetzt ist.
Außerdem gibt es weitere Hinweise auf häusliche Gewalt, die auch für den Bereich der zahnärztlichen Versorgung wichtig sind: Die Betroffenen haben verschiedene Verletzungen in unterschiedlichen Heilungsstadien oder solche, die nicht mit der Erklärung ihrer Entstehung übereinstimmen. Sie verzögern möglicherweise einen Arztbe such, obwohl sie behandlungsbedürftig sind.
Wann Ärzte nachfragen
Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass eine große Kluft zwischen der Selbsteinschätzung von Ärzten, fachlich verantwortlich zu sein, und ihrem tatsächlichen Nachfrageverhalten besteht, wobei dies die Voraussetzung für eine gute Versorgung ist.
Erfahrungsgemäß sprechen Frauen selten von sich aus Gewalterfahrungen an, bagatellisieren sie aus Angst und Scham, deuten ihre Ursachen um und erklären die Folgen häufig mit einem häuslichen Unfall. Bedenkt man, dass sich Ärzte selbst in der Verantwortung sehen, müssten sie während der Behandlung Gewalt als Ursache von Verletzungen thematisieren. Dies geschieht jedoch in der Praxis selten.
Mit einem Anteil von 7,5 Prozent ist nur ein sehr kleiner Teil der Frauen jemals von ihrem Arzt nach Gewalterfahrungen gefragt worden. 67 Prozent der Patientinnen wünschten sich dies aber im Fall von erlittener häuslicher Gewalt [Hellbernd et al., 2004]. Für viele Betroffenen sind Mediziner die ersten, teils einzigen Ansprechpersonen nach Gewalteinwirkungen. Dies unterstreicht, wie relevant diese Berufsgruppe der gesundheitlichen Versorgung ist [BMFSFJ 2004].
Gesundheitssektor nimmt Schlüsselrolle ein
Seit etwa zehn Jahren gibt es in Deutschland Bemühungen, die gesundheitliche Versorgung von Frauen zu verbessern, die häusliche Gewalt erlebt haben. Eine der ersten Anlaufstellen ist die stationäre und ambulante Gesundheitsversorgung, die Betroffene zur Behandlung der körperlichen und psychischen Folgen aufsuchen. Damit kommt diesen beiden Versorgungsbereichen eine Schlüsselrolle zu.
Gerade im Rahmen der ambulanten Versorgung besteht – neben der primären Behandlung – die Möglichkeit, Gewalt zu erkennen und Frauen zu unterstützen. Schließlich ist diese Versorgung in der Regel durch ein besonderes Vertrauensverhältnis gekennzeichnet. Dabei spielt eine große Rolle, wie kompetent und sensibel der Mediziner diagnostiziert und behandelt. Zudem kann er ergänzende Angebote vermitteln, die weiteren häuslichen Übergriffen vorbeugen können.
Als allgemeine Interventionsstandards gelten heute:
1. das Erkennen gewaltbedingter Verletzungen und Beschwerden sowie das Ansprechen der Patientin auf den Gewalthintergrund,
2. das Dokumentieren der gesundheitlichen Folgen und
3. das Informieren, Aufklären über weiterführende Beratungs- und Schutzangebote.
Entsprechende Projekte der Sensibilisierung und Qualifizierung von Medizinern im stationären und ambulanten Bereich sind beginnend mit dem Berliner S.i.g.n.a.l.-Interventionsprojekt in den letzten Jahren in Deutschland initiiert und erfolgreich durchgeführt worden.
Neben konkreten Praxisprojekten, die in einzelnen Bundesländern wie auch länderübergreifend stattfinden, verfügt mittlerweile nahezu jedes Bundesland über Handlungsleitlinien und ärztliche Dokumentationsbögen für körperliche und sexualisierte Gewalt. Sie beinhalten Hinweise zur Verbesserung der Diagnose, einer adäquaten Behandlung und zur Bedeutung und Durchführung einer gerichtsverwertbaren Dokumentation der Verletzungen, um Patientinnen auch zu rechtlichen Schritten zu ermutigen. Diese Empfehlungen und Instrumente bilden eine zentrale Grundlage, um die Versorgung bei häuslicher Gewalt zu verbessern.
Der zahnärztliche Versorgungsbereich kann auf diese vielfältigen Erfahrungen, Leitlinien und Dokumentationsbögen zurückgreifen, bedarf aber aufgrund der Besonderheiten der Verletzungen einer eigenständigen spezialisierten Herangehensweise. Dies gilt insbesondere für die Dokumentation der Vielfalt möglicher Verletzungen im Hals- und Kopfbereich sowie den Umgang mit traumatisierten Patientinnen in schwierigen Behandlungssituationen.
Eine im Jahr 2007 von der Hochschule Fulda durchgeführte standardisierte Befragung der hessischen Zahnärzteschaft zu ihren Erfahrungen im Umgang mit gewaltbetroffenen Frauen und ihrem Handlungsbedarf ergab, dass sich 57 Prozent der Zahnärzte in der Rolle der Ansprechperson bei häuslicher und sexualisierter Gewalt sehen, weitere 23 Prozent zumindest teilweise [Blättner et al., 2008]. Dies stimmt mit internationalen Daten weitgehend überein [Aved et al., 2007; Johnston et al., 2003].
Mehr als 90 Prozent sehen konkrete Handlungsanleitungen im Umgang mit gewaltbetroffenen Patientinnen als hilfreich an und wünschen sich Hinweise auf Beratungsstellen oder Informationsmaterial zum aushändigen [Blättner et al., 2008; Skelton et al., 2007]. Mehr als 50 Prozent halten sich nicht für ausreichend über das Thema informiert [Blättner et al., 2008].
Empfehlungen für den Alltag sind in Arb
Vor diesem Hintergrund startete an der Hochschule Fulda im Sommer 2008 ein Projekt. Die Forscherinnen suchen im internationalen Vergleich nach Handlungsempfehlungen und Leitlinien zur zahnärztlichen Diagnostik, Dokumentation und Versorgung von betroffenen Frauen. Das Hessische Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit unterstützt das Vorhaben, das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst finanziert die Arbeit.
Ein Ziel des Projektes „ZuGang“ ist zu prüfen, inwieweit Handlungsempfehlungen und Leitlinien anderer Länder auf das deutsche Versorgungssystem übertragbar sind. Zudem wollen die Projektverantwortlichen gemeinsam mit ihrem Beirat entsprechende Empfehlungen für das deutsche Versorgungssystem ableiten. Weiterhin zielt das „ZuGang“ darauf, einen Dokumentationsbogen zu erstellen. Dieser soll den mittlerweile anerkannten Anforderungen – wie der Gerichtsverwertbarkeit – entsprechen und im zahnärztlichen Arbeitsalltag handhabbar sein.
Ergebnisse des Fuldaer Projekts werden neben einem in der zahnärztlichen Praxis einsetzbaren Dokumentationsbogen Handlungsempfehlungen sein, die den Umgang von Zahnärzten mit betroffenen Patientinnen erleichtern und verbessern sollen.
Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Fuldaer Projektes:http://www.hs-fulda.de/index.php?id=7384.
Prof. Dr. Daphne HahnFachbereich Pflege und GesundheitHochschule FuldaMarquardstraße 3536039 Fuldadaphne.hahn@pg.hs-fulda.de