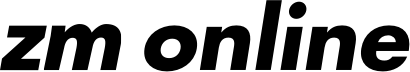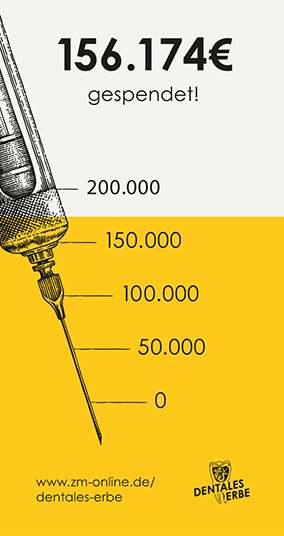Gesellschaftlicher Konsens für mehr Eigenverantwortung
Professor Staehle stellt in den zm die Entwicklung in der Zahnmedizin, dass „Mundgesundheit zum Konsumartikel“ werde, als sachlich nicht gerechtfertigt und gesundheitspolitisch gefährlich dar. Er kritisiert dabei folgende auch in den Medien diskutierte Fragestellungen:
– Sind Zahnärzte im bestehenden Gesundheitssystem „moralisch verwerfliche Vielverdiener, die sich unverfroren aus der Staatskasse bedienen würden“?
– Führt der finanzielle Druck von Privatisierung beim Bürger zu besserem Mundgesundheitsverhalten?
Prof. Staehle kommt zu dem Schluss, die Eingangsthese beinhalte einen zahnmedizinisch historischen Rückschritt im Sinne einer Distanzierung von der Humanmedizin und offenbare eine bedenkliche Wandlung im Selbstverständnis von Teilen der Zahnärzteschaft.
Drei dicke Fragezeichen
Vorab dazu: Staehles Eingangsthese „Mundgesundheit als Konsumartikel“ benötigt mindestens drei dicke Fragezeichen.
Mundgesundheit ist integraler Bestandteil der Heilkunde. Jegliche Distanzierung der Zahnheilkunde von der Medizin führt zu einer für den Berufsstand gefährlichen Diskussion, die Staehle zutreffend umrissen hat. Sofern in einigen Kommentaren die Patienten trotzdem auch als „Kunden“ bezeichnet werden, ist dies nur ein Ausdruck dafür, dass heutzutage bei in der Regel höherem finanziellen Einsatz der Patienten, diese für ihre Entscheidung auch intensiver beraten werden müssen, als früher in Zeiten der „Vollversorgung“.
Bei der Diskussion um die Sinnhaftigkeit einer Privatisierung der Zahnheilkunde müssen einige Fragen untersucht werden:
1. Löst ein höheres Maß an Eigenbeteiligung in der Zahnmedizin die finanziellen Probleme der bestehenden gesetzlichen Krankenversicherung?
Sicherlich nicht. Der derzeitige Anteil für zahnärztliche Leistungen am Gesamtvolumen der GKV ist in den vergangenen Jahren durch diverse gesetzliche Eingriffe bereits auf sieben bis acht Prozent zurückgegangen. Die vollständige Ausgliederung der Zahnmedizin aus der GKV würde den Krankenkassen-Beitragssatz nur um etwa ein Prozent entlasten. Ein solches Szenario ist politisch weder durchsetzbar, noch wäre damit eine nachhaltige Finanzierung der GKV gesichert.
2. Führt ein höheres Maß an Eigenbeteiligung in der Zahnmedizin zu mehr Mundgesundheit?
Höhere Eigenbeteiligungen führen zunächst nur zu einer Reduktion der solidarisch finanzierten Ausgaben. Aus niedrigeren Ausgaben (wie in der Schweiz) darf aber nicht auf bessere Zahngesundheit geschlossen werden.
Im Gegenteil: Nicht leistbare Privat-Ausgaben für orale Rehabilitation führen zu einer Unterversorgung. Für viele Patienten beginnt mit jeder Eigenbeteiligung de facto eine persönliche Priorisierungsdebatte. Bei manchen Patienten sitzt der „Konkurrent“ des Zahnarztes – so gesehen – in der Tat im Reisebüro, beim Kfz-Gewerbe oder anderswo.
3. Ist eine selektive Privatisierungs-Debatte für den Bereich Zahnmedizin überhaupt fachlich gerechtfertigt?
In den vergangenen Jahren hat es hinsichtlich der Verschuldungsabhängigkeit von oralen Erkrankungen einige Erkenntnisgewinne gegeben. Die These „Ein sauberer Zahn erkrankt nicht“ ist wissenschaftlich widerlegt. Zwar gilt nach wie vor der Lehrsatz „Prophylaxe schützt“, aber weite Teile der ZMK-Erkrankungen unterliegen offensichtlich auch anderen Parametern als der persönlichen Mundhygiene. Die kausalen Beziehungen zwischen Medizin und Zahnmedizin sind intensiver als das in früheren Zeiten gelehrt oder kolportiert wurde.
Mitnahme-Effekte verhindern
Sofern man die Berechtigung von höheren Eigenbeteiligungen in der Zahnheilkunde an der „Schuldfrage“ seitens des Individuums festmachen will, wäre heute – unter den oben genannten Voraussetzungen – die Eigenverantwortung eher kleiner als früher vermutet einzuschätzen.
4. Welche Konsequenzen hätten höhere Eigenbeteiligungen in der Zahnmedizin für die Patienten?
In den Zeiten höherer Kostenübernahmen für Zahnersatz durch die GKV ist es punktuell zweifelsohne auch zu Überversorgungen gekommen. Da es bei der Kronen- und ZE-Versorgung neben der Wiederherstellung der Kaufunktion nicht selten auch um die Verbesserung ästhetischer beziehungsweise kosmetischer Bedürfnisse geht, waren solche Mitnahme-Effekte („moral hazard“) erklärbar und verständlich – sowohl auf Patienten- als auch auf Behandlerseite. Diese Effekte sind durch die Herabsetzung der prozentualen Zuschüsse und später durch die Umstellung auf Festzuschüsse in den Hintergrund getreten. Für einzelne ZE-Versorgungen mit Härtefall-Regelung gilt das jedoch auch heute noch.
Eine weitere Absenkung der GKV-Festzuschüsse für Zahnersatz würde insbesondere das finanziell schwächer gestellte Patientenklientel, das noch nicht der Härtefall-Regelung unterfällt, tendenziell von notwendigen Versorgungen abhalten.
Die Folge wäre Unterversorgung mit denkbaren Langzeitschäden. Dieser Effekt könnte durch eine gleitende Härtefall-Regelung abgemildert werden.
In der Parodontopathie-Behandlung würde die Einführung von Eigenbeteiligungen einerseits einen motivierenden Effekt im Sinne von intensiveren Gesunderhaltungsbemühungen haben. Auf der anderen Seite würde bei der erheblichen PAR-Morbidität der ohnehin schon beklagenswert geringe Sanierungsfaktor tendenziell noch weiter absinken.
Im Sektor KBr.-Behandlung hat die Einführung der vollen Kostenübernahme vor Jahren zu einer gewissen „Knirsch- und Press-Epidemie“ geführt. Aufgrund vieler nur schwach objektivierbarer Behandlungsfälle ist in diesem Fall eine tendenzielle Überversorgung festzustellen, die durch entsprechende Kosten-Maßnahmen korrigierbar wäre.
Die Einführung von Eigenbeteiligungen bei konservierenden, hier insbesondere endodontischen Maßnahmen würde gegebenenfalls manche zahnerhaltende Maßnahmen unterbleiben lassen. Die Folge wären ebenfalls Unterversorgung und gegebenenfalls Folgekosten, die für die Beteiligten (Kasse und Patient) im Einzelfall gewichtiger zu Buche schlagen würden. Bei Betrachtung eines Bevölkerungsquerschnitts würde sich die soziale Spreizung im Grad der oralen Gesunderhaltung tendenziell verstärken.
Ein hohes Maß an Eigenverantwortung
Allerdings hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass große Teile der Bevölkerung auf Einschnitte in der GKV-Zahnversorgung mit dem Abschluss von Zahnzusatz-Versicherungen unterschiedlicher Ausprägung reagieren. Insofern ist das Problembewusstsein vielfach vorhanden, und auf die Konsequenzen von Veränderungen im Leistungsgeschehen wird vielfach angemessen reagiert.
5. Ist ein höheres Maß an Eigenverantwortung und damit an finanzieller Eigenbeteiligung generell oder gerade nur in der Zahnmedizin indiziert?
Die wissenschaftlich gesicherte Verflechtung der Zahnmedizin mit der Humanmedizin (siehe Punkt 3) macht es zunehmend zweifelhafter, die jahrelang – auch von großen Berufsverbänden – geführte Privatisierung-Debatte unverändert und unreflektiert fortzusetzen. Vor dem Hintergrund einer gesundheitspolitisch notwendigen Steuerung von Gesundheitsausgaben („Für begrenzte Mittel gibt es nur begrenzte Leistungen“) wird die Privatisierung-Debatte jedoch im Sinne einer Priorisierung-Debatte weiter geführt werden müssen. Derartige Entscheidungsprozesse müssen jedoch den gesamten Sektor der solidarischen Gesundheitsversorgung umfassen. Eine isolierte Zielprojektion auf die Zahnmedizin macht aus fachlichen Gründen nur eingeschränkt Sinn. Eine Lösung der Finanzierungsprobleme der GKV würde damit ohnehin nicht erreicht.
Deshalb: Ein höheres Maß an Eigenverantwortung und damit eine finanzielle Eigenbeteiligung für die persönliche Gesundheitsversorgung ist unumgänglich, weil das System anderenfalls aus dem Ruder läuft.
6. Warum ist ein höheres Maß an finanzieller Eigenbeteiligung der Patienten erforderlich?
Die Problematik der alternden Bevölkerung und damit verbunden höherer Gesundheitsausgaben ist bekannt. Die Dynamik des medizinischen Fortschritts liegt seit Jahrzehnten oberhalb der Entwicklung des Bruttosozialprodukts. Die Veränderungen in der Arbeitswelt, das tendenzielle Absinken des Anteils aus (krankenversicherungsrelevantem) Arbeitseinkommen hält mit dem Kostenschub durch diese Hauptfaktoren bei den Gesundheitsausgaben nicht mehr Schritt.
Ohne steuernde Eingriffe in das jetzige GKV-System wird der GKV-Beitragssatz nach ernstzunehmenden Berechnungen (Beske, Kiel) im nächsten Jahrzehnt 20 Prozent übersteigen und langfristig sogar 30 Prozent erreichen. Solche Belastungen wären politisch nicht vermittelbar und würden die ohnehin schon hohen Arbeitskosten in Deutschland weiter verteuern.
Alternativ ist ein höherer Finanzierungsanteil der GKV-Kosten aus Steuermitteln denkbar. Damit wäre jedoch das Problem einer nachhaltigen Finanzierung nicht gelöst, sondern lediglich zu Lasten nachfolgender Generationen auf die „lange Kreditbank“ geschoben. Mit dem verstärkten Anschluss des GKV-Systems an den Tropf aus Steuermitteln geriete die GKV überdies zunehmend unter den Einfluss der aktuellen politischen Wetterlage und der aktuellen Kassenlage des Staatshaushalts.
In die Selbstausbeutung getrieben
Gesundheitsleistungen würden nach Kassenlage des Staates gewährt werden. De facto bestehende Rationierungen spielen in jedem Wahlkampf eine Rolle.
Die Heilberufe würden bei sinkender Honorierung immer stärker in die Selbstausbeutung getrieben werden. So lange, bis sich die freie Praxis nicht mehr lohnt und das Prinzip des angestellten Arztes in einer – von wem auch immer – betriebenen Poliklinik greift. Die derzeit noch amtierende Bundesgesundheitsministerin verfolgt diese Ziele ohne großes Versteckspiel.
Finanzielle Eigenbeteiligungen des Patienten an Gesundheitsleistungen werden häufig als Argumente der Ungerechtigkeit in einer Gerechtigkeitsdebatte angeführt. Diese Debatte ist aber ungeeignet, denn bezahlen muss der Patient die Leistung ohnehin: entweder direkt oder über Umverteilungssysteme.
Eine solidarische Absicherung des Risikos „Krankheit“ ist breiter gesellschaftlicher Konsens. Gestritten wird allenfalls über den Umfang der solidarisch zu finanzierenden Leistungen. Das GKV-System verteilt die Lasten seiner Finanzierung nicht gleichmäßig, sondern es belastet die Besserverdienenden über den Beitragssatz stärker (bis zur Beitragsbemessungsgrenze) als die Geringverdienenden. Der Oberarzt im Krankenhaus zahlt also mehr Kassenbeiträge als die Krankenschwester – bei gleichem Leistungsanspruch.
Eine weitere Umverteilung findet über die Progression der Steuersätze bei höherem Einkommen statt, so dass auch steuerfinanzierte Ausgaben im Gesundheitssystem in höherem Maße von den „Reichen“ getragen werden.
Die Gerechtigkeitsdebatte wird nie beendet sein. Es wird immer Stimmen geben,
- die die Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze fordern (Ergebnis: Einheitsversicherung ohne PKV),
- die die Anhebung oder Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze fordern (Ergebnis: noch höhere Kassenbeitragsunterschiede bei identischem Leistungsanspruch),
- die eine stärkere Steuerfinanzierung fordern (Ergebnis: siehe oben).
Von „besonders sozialen“ Diskutanten wird gern eingebracht, alle Gesundheitsleistungen müssten für jedermann ohne Schranken zugänglich sein. Diese Forderung kann man unterschreiben, sofern zuvor die Priorisierungsdebatte abgeschlossen ist. Die pauschale Forderung, alles müsse für jedermann unbeschränkt verfügbar sein, erinnert an die Zustände im Schlaraffenland und weckt Zweifel an der Kompetenz des Fordernden.
Höhere Eigenbeteiligung unabdingbar
An dem Punkt der Priorisierung gilt es zwischen horizontaler und vertikaler Priorisierung zu unterscheiden. In einer Rangfolge der Gesundheitsleistungen von „unverzichtbar“ und „sehr wichtig“ bis „unwichtig“ und „überflüssig“ wird in einem gesellschaftlichen Konsens ein horizontaler Strich gezogen werden müssen. Die Leistungen oberhalb dieser Linie gehören dann in den Katalog der Solidarversicherung. Dabei wird zusätzlich unterstellt, dass diese Leistungen nur im Falle der individuellen medizinischen Notwendigkeit geleistet werden.
Die vertikale Priorisierung stellt bei den medizinischen Leistungen eine andere Reihenfolge dar: Hier muss unterschieden werden, welche Leistungen aus der Solidarkasse vollständig zu tragen sind, und bei welchen anderen Leistungen Eigenanteile des Patienten – gegebenenfalls in abgestufter Höhe – vorzusehen sind.
Dem vielfach in die Diskussion geworfenen Argument des faktischen Ausschlusses Minderbemittelter von zuzahlungspflichtigen Leistungen kann durch geeignete Grenzbelastungsregelungen begegnet werden. Derartige Befreiungen sollten aber erst auf Antrag unter vollständiger Offenlegung der persönlichen Besitzverhältnisse möglich sein.
Generell gilt: Zur Stabilisierung der GKV-Ausgaben auf dem heutigen Niveau (das vielfach schon als zu hoch angesehen wird) ist eine insgesamt höhere Eigenbeteiligung der Patienten unabdingbar. Während in einigen Sektoren der Zahnheilkunde Eigenbeteiligungen bereits ein erhebliches Maß erreicht haben, sind sie in anderen Bereichen der ärztlichen Versorgung nur sehr beschränkt vorhanden.
Bei welchen ärztlichen Leistungen im Detail Eigenbeteiligungen in welchem Ausmaß sinnvoll sind, soll nicht von einem Zahnarzt diskutiert werden. In der Tendenz bedürfen die großen vitalen Lebensrisiken einer weitgehend vollständigen Absicherung. Kleinere Risiken, deren Eintritt recht wahrscheinlich und insofern für den Menschen geradezu planbar sind, können dagegen mit Eigenbeteiligungen belegt werden. Die Frühjahrs-Erkältung kommt in der Regel nicht so überraschend wie der Feuerschaden am eigenen Haus.
Zählt man eine angemessene solidarische Gesundheitsversorgung zu den menschlichen Grundbedürfnissen, die die Gesellschaft insgesamt zu befriedigen hat, kommt man zu folgender Erkenntnis: Zur Stillung von Grundbedürfnissen wie Ernährung, Wohnung und anderem kommt der Mensch eigenverantwortlich selber auf. Nur wenn er dabei in eine Überforderungssituation gerät, wird ihm Hilfe in Form von Transferleistungen angeboten.
Ein ähnliches Prinzip ließe sich auch für die Gesundheitsversorgung denken. Wegen hier bestehender Unvorhersehbarkeiten besteht eine Basisabsicherung, sei es in Form der bestehenden GKV, sei es in Form einer Pflicht zur Absicherung einer Grundversorgung.
Ein nicht unwesentlicher Teil von Gesundheitsleistungen hat nicht den Charakter von Versicherungsleistungen, weil ein Teil des „Schadenseintritts“ vorhersehbar ist. Sofern sich die Bevölkerung also darauf einstellen würde, für den „planbaren Teil“ der in Anspruch zu nehmenden Gesundheitsleistungen eigene Vorsorge zu treffen, hätte dies eine ähnliche Qualität wie die monatliche oder jährliche Planung von Haushalts-Budgets für andere Bedürfnisse wie zum Beispiel Miete, Lebensmittelkosten und so weiter.
Das Argument höherer Folgeschäden im Unterlassensfall zählt in der Gesundheitsversorgung wie in anderen Lebenslagen. Die Nichtzahlung der Miete oder die Verweigerung einer angemessenen Ernährung ist in ihren Folgen nicht immer sofort einsichtig, in der Regel jedoch überschaubar und damit in der Verantwortung des Individuums. Gleiches gilt auch für die Folgen des Unterlassens von Heilbehandlung, wenn (zahn-) medizinischer Rat zur Verfügung gestellt wird.
Umsteuerung erfordert politischen Willen
Eine nachhaltige Umsteuerung erfordert politischen Willen. Bei dem (nicht ganz vergleichbaren) Thema der gesetzlichen Rentenversicherung hat das nach jahrelangem vergeblichen Gesundreden (Blüm: „Die Rente ist sicher.“) unter dem Logo „Riester-Rente“ auch irgendwie geklappt.
7. Welche Veränderungen bei der Eigenbeteiligung der Patienten sind in der Zahnmedizin möglich?
Realistische Szenarien beinhalten die Einschätzung der Möglichkeit von politischen Umsetzungen. Da Eingriffe in die Gesundheitsversorgung politisch als hochsensibel gelten, ist eine verbreitete Scheu für Veränderungen bei den (wieder zu wählenden) Volksvertretern festzustellen. Deshalb wagt man sich bestenfalls in evolutionären Schritten an die Thematik, am liebsten auf Wegen, die bereits begangen wurden, ohne dass Absturz drohte. In der Zahnmedizin sind das Mehrkosten-Regelungen und Festzuschüsse. Bei aller Lästigkeit der Detail-Regelungen im Zahnersatz-Festzuschuss-System kann festgehalten werden: Das Zahnersatz-Festzuschusssystem hat sich gegenüber dem vorherigen prozentualen Zuschusssystem aus ordnungspolitischer Sicht bewährt. Leider nimmt es auf regionale Besonderheiten wie zum Beispiel Kostenunterschiede keinerlei Rücksicht.
Für die unbeeinflusste Arzt-Patienten-Beziehung
In der Füllungs-Therapie ist die Mehrkosten-Regelung etabliert und gesundheitspolitisch allseits akzeptiert. Füllungen und andere „kleine“ konservierende Leistungen könnten allerdings in die Eigenverantwortung überstellt werden, weil sie einerseits „quasi planbar“ sind, andererseits den Patienten in der Regel auch nicht überfordern.
In der Parodontaltherapie unterscheiden sich die Behandlungs-Alternativen im Wesentlichen aufgrund der Schwere der Erkrankung. Eigenbeteiligungen sind hierbei allein schon aus motivierenden Gründen erforderlich. Wegen des Charakters der Erkrankung erscheint ein Festzuschuss besser als eine Mehrkosten-Regelung geeignet zu sein. Eine Leichttherapie in einem Frühstadium wäre relativ höher bezuschusst als eine Therapie an länger vernachlässigten Parodontien. Ein Festzuschuss in der Parodontaltherapie würde auch dem ansteigenden Risiko bei höheren Taschentiefen mehr gerecht werden als eine Mehrkosten-Regelung.
Bei der Schienenbehandlung mag Ähnliches gelten.
In der Endodontologie ist die Einschätzung eine andere: Hier hat die Wissenschaft Verfahren entwickelt, die mit besonderem Aufwand die Erfolgsrate ansteigen lassen. Solche Therapien sind als Standardleistung in der GKV nicht bezahlbar, müssen aber dem Patienten offen stehen, ohne dass er dabei seinen Anspruch auf die GKV-Leistung verliert. Das derzeitige System verbietet die Berechnung von Mehrkosten auf die GKV-Leistung. Das ist fachlich und ordnungspolitisch nicht mehr nachvollziehbar. Deshalb muss dieser Sektor für eine Mehrkosten-Regelung geöffnet werden.
Führt die Privatisierung der Zahnheilkunde zu besserem Mundgesundheitsverhalten?
Nein. Es ist auch nicht Staatsaufgabe, den Menschen zu „besserem Verhalten“ zu bewegen. Jedes Mehr an Zahnfürsorge verbessert die Mundgesundheit. Aber Prävention ist wie eine Kurve, die Mund und Zähne dem Idealen nähern, sie aber nie erreicht. Auch höchster Aufwand – aus welcher Kasse auch immer – wird den Zustand der Unvollkommenheit zementieren. Insofern geht es nicht um Privatisierung oder Sozialisierung der Zahnheilkunde, sondern um das Schaffen von Anreizsystemen, ohne dabei den Zugang zu einer sinnvollen Grundversorgung zu verlegen. Über Umfang und Ausmaß der solidarisch bezahlbaren Versorgung und das Ausmaß der Eigenverantwortlichkeit muss ein gesellschaftlicher Konsens hergestellt werden. Er ist nicht zahnärztlich, sondern nur politisch unter fachlicher Beratung festzulegen.
Die hier angeführten Gedanken und Optionen sind ausdrücklich auf die Chancen für Veränderungs-Potenziale nach den Bundestagswahlen ausgerichtet. Sie bleiben aus meiner Sicht dennoch die zweite Wahl gegenüber einer vollständigen Privatisierung der Zahnheilkunde mit einer Pflicht zur Absicherung einer zahnmedizinischen Basisversorgung auf privatrechtlicher Basis. Das Ganze eingebettet in die Direktabrechnung der Zahnmedizin mit Kostenerstattung aus Gründen der Transparenz und den Vorteilen einer unbeeinflussten Zweierbeziehung.
Dr. K. Ulrich Rubehn ist Präsident der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein und war bis vor Kurzem Stellvertretender Bundesvorsitzender im FVDZ. Er stellt hier seine persönliche Auffassung dar.